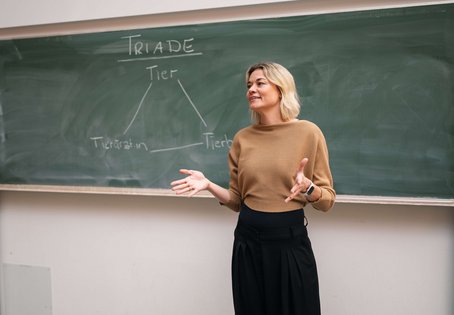- Startseite /
- Forschung /
- Aktuelles aus der Forschung
- Tierwohl messen: vom Affekt bis Telomer – Janja Sirovnik im Porträt
Forschung
Tierwohl messen: vom Affekt bis Telomer – Janja Sirovnik im Porträt
Was macht ein glückliches Huhn aus? Diese Frage treibt Janja Sirovnik schon seit ihrer Kindheit um. Heute erforscht die Assistenzprofessorin an der Vetmeduni, wie sich Tierwohl über die gesamte Lebenszeit kumuliert – nicht nur als Ist-Zustand – messen lässt. Sie hat ein paar interessante Indikatoren am Start.

Gefiedertes Glück: In der Gruppe von Janja Sirovnik sollen Tierwohl und ein gutes Leben messbar werden.
Als kleines Mädchen war Janja Sirovnik oft bei den Großeltern am Land und versorgte dort ein Zwerghuhn und eine Ente, die auf einem Auge blind war: „Ich habe sie im Puppenkinderwagen herumgefahren. Ob ihr das gefallen hat, weiß ich nicht.“ Seit dem Doktorat beschäftigt sie sich mit der Suche nach Indikatoren für Tierwohl, kumulierte Lebensqualität und tierische Affekte, mit Februar 2025 wurde die Geflügelexpertin zur Assistenzprofessorin ernannt. Noch vor dem Abschluss in Veterinärmedizin an der Universität Ljubljana spürte sie, dass sie mehr wollte, als individuelle Tiere zu heilen: „Ich wollte mehr und für mehr Tiere tun – Forschung erschien mir dafür der bessere Weg.“ Sie suchte aktiv nach Fachleuten im Feld Tierwohl und fand einen Professor, der sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin für ein Jahr an die Universität Bern vermittelte. Die gebürtige Slowenin hängte danach noch einen PhD in Biomedizin an.
Deutsch sprach sie vor ihrer Abreise kein Wort und Englisch nicht gut, aber „ich bin stur. Meine Leidenschaft war größer als meine Angst“. Sie lernte in den folgenden Jahren viel über Tierschutzwissenschaften und Geflügel. Und sie lernte Deutsch – in vielen Varianten –, verknüpft mit weiteren Stationen in Wageningen (Niederlande), als Postdoc in Gießen und seit 2020 in Wien.
Von der Unsicherheit zur Unabhängigkeit
Im Doktorat legte sie das Fundament für ihre aktuelle angewandte Forschung und hatte die zündende Idee für ihre Grundlagenforschung. 2017 hörte sie einen TED Talk von Elizabeth Blackburn. Die Nobelpreisträgerin erzählte darin, dass unglückliche und mit ihrem Leben unzufriedene Menschen rascher kürzere Telomere aufweisen. Telomere sind Gensequenzen, die bei allen Wirbeltieren wie Schutzkappen an beiden Enden der Chromosomen sitzen: „Das brachte mich auf die Idee, diese als Indikator für Lebensqualität oder kumulierte Erfahrung von Tieren nutzbar zu machen.“
2020 kam sie in die Arbeitsgruppe Tierschutzwissenschaften und Tierhaltung am Zentrum für Tierernährung und Tierschutzwissenschaften und unterrichtet seither auch im Fachbereich Geflügel zu Verhalten, Haltung und Tierschutz. Kurze Zeit nach ihrer Ankunft verstarb der langjährige Geflügelexperte: „Ich habe mich wie ein Küken gefühlt und bin in sehr große Fußstapfen gestiegen. Knut Niebuhr war sehr anerkannt, aber zum Glück ist die Community klein und gut vernetzt, also kannte ich bald alle.“ Die rezente Berufung zur Assistant Professor macht sich für die 40-Jährige nicht so sehr in der Art der Arbeit bemerkbar, sondern eher in dem Gefühl, ihre Forschung über längere Zeit verfolgen zu können.

"Tiere sammeln ihr ganzes Leben lang positive und negative Erlebnisse. Leider können wir den Einfluss all dieser Erlebnisse auf ihr Wohlbefinden mit derzeitigen Methoden nicht beurteilen."
Gedächtnis der Gene, Stimmung im Stall
Das grundlegende Problem bei der Tierwohl-Beurteilung ist, dass nur der aktuelle Zustand erhoben werden kann. Meist werden die Vögel gewogen, der Zustand ihrer Füße, Brustbeine und des Gefieders beurteilt: „Tiere sammeln aber ihr ganzes Leben lang positive und negative Erlebnisse. Leider können wir den Einfluss all dieser Erlebnisse auf ihr Wohlbefinden mit den derzeitigen Methoden nicht beurteilen. Wir brauchen Indikatoren für die Lebensqualität bis zum jeweiligen Messzeitpunkt.“
Neben den Telomeren werden in ihrer Forschungsgruppe inzwischen einige weitere Biomarker zum Beispiel aus Immunologie, Mikrobiom oder Epigenetik erhoben und abgeglichen, ob sie – je nach den Lebensbedingungen der Vögel – in die gleiche Richtung weisen. In kontrollierten Experimenten wird auf der einen Seite der Einfluss von positiven Erfahrungen in einer besonders angereicherten Stallumgebung geprüft. Auf der anderen Seite wird der Einfluss von Stress untersucht und die Hühner werden dazu mit Stressoren, die ihnen im Stall begegnen können, konfrontiert. Dazu gehören zum Beispiel Transport, Wind oder Isolation.
Das Ziel ist, einen wenig invasiven Indikator für die Lebensqualität zu finden. Als wäre das nicht komplex genug, beschäftigt sich Janja Sirovnik auch mit der Gemütsverfassung der Hühner – ob sie eher eine optimistische oder pessimistische Tendenz haben –, aktuell validiert sie Verhaltenstests, die den affektiven Zustand von Hühnern bewerten können. Die Arbeitsgruppe muss nun einige Zeit ohne die Leiterin auskommen, weil sie in Babykarenz ist. Es stehen also wieder ganz neue Herausforderungen in ihrem Leben an. Neben einem Hund und einer Katze zählt Janja Sirovnik Gartenarbeit zu ihren Hobbys. Eigene Hühner hat sie nicht, aber ihre Arbeit führt ihr täglich vor Augen, was sie schon lange weiß: Diese Vögel sind ziemlich individuell.
Text: Astrid Kuffner
alle Fotos: Thomas Suchanek/Vetmeduni
Der Beitrag ist in VETMED 02/2025 erschienen.