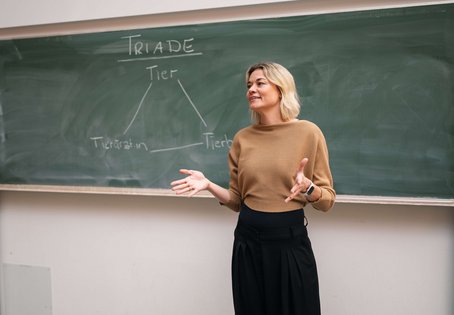- Startseite /
- Universität /
- Infoservice /
- News /
- Tierischen Emotionen auf der Spur – Stefanie Riemer im Porträt
Forschung
Tierischen Emotionen auf der Spur – Stefanie Riemer im Porträt
Ein treuherziger Hundeblick lässt fast jeden Menschen dahinschmelzen. Jedoch haben Hunde und auch andere Tiere noch viel mehr Emotionen. Wie man diese besser verstehen kann, erforscht Stefanie Riemer, Assistenzprofessorin für Companion Animal Management am Messerli Forschungsinstitut der Vetmeduni.

Wir Menschen sind nicht die einzigen Lebewesen mit komplexem Innenleben. Wer mit einem Hund zusammenlebt, hat wohl wenig Zweifel daran, dass dieser auch Gefühle hat und sie ausdrücken kann. Einst als Vermenschlichung umstritten, sind Emotionen bei Tieren mittlerweile in vielen Fachkreisen anerkannt. Stefanie Riemer, Assistenzprofessorin für Companion Animal Management am Messerli Forschungsinstitut der Veterinärmedizinischen Universität Wien, erforscht diese tierischen Emotionen. „Schon seit meiner Kindheit haben mich Tiere und deren Verhalten interessiert“, erzählt Riemer. „Nun konzentriere ich mich darauf, wie man die Emotionen von Hunden besser verstehen und ihr Wohlergehen verbessern kann.“ Ihre Arbeit verbindet Grundlagenforschung über das Innenleben dieser Tiere mit konkreten Anwendungsfällen und Handlungsanleitungen, um ihnen und ihren Besitzer:innen zu helfen.
Glückliche Patienten in der Tierarztpraxis
Wie so manche Menschen haben viele Haustiere auch Angst vor einem Arztbesuch. In einigen Studien untersuchte Riemer Maßnahmen gegen diese Angst, wie etwa Futterbelohnungen und sogenannte „Happy Visits“ positive Stimmung in der Tierarztpraxis fördern können. Zusammen mit mehreren Kolleginnen der Vetmeduni verfasste Riemer eine umfassende Übersichtsarbeit zum Thema „Angst und Aggression bei Hunden und Katzen im tierärztlichen Setting minimieren“, welche vielfach zitiert und sogar ausgezeichnet wurde. Riemer erklärt die Motivation hinter ihrer Forschung: „Mir ist wichtig, dass wir mit unserer Arbeit den Tieren und ihren Menschen auch direkt helfen können.“
Silvesterangst
Eine weitere bekannte Stresssituation für Hunde ist der Lärm der Feuerwerke am Silvesterabend. Hier halfen Hundehalter:innen im Rahmen eines Citizen-Science-Projekts dabei, die Daten für eine Studie zu erheben. Sie machten Videos vom Verhalten ihrer Tiere am Silvesterabend und zum Vergleich auch an einem normalen Abend, die anschließend ausgewertet wurden. Forschende fanden verschiedene Anzeichen für Stress im Verhalten der Hunde, wie die Stellung der Ohren, unruhige Bewegungen und Hecheln. Riemer ergänzt: „Wir stellen die klassische Aussage aus fast jedem Hundebuch in Frage, dass nur angelegte Ohren auf Angst hindeuten. Bei stehohrigen Hunden mit Geräuschangst zeigte sich aber, dass die Ohren in der Feuerwerkssituation zwar nach hinten gerichtet, aber nicht angelegt waren – die Tiere sind gleichzeitig wachsam. Angelegte Ohren lassen sich hingegen überwiegend in sozialen Kontexten beobachten.“
Riemer hat viel konkrete Erfahrung mit Hunden. Vor ihrer letzten Anstellung an der Vetmeduni bot sie im Rahmen ihres Unternehmens namens „HundeUni – Wissenschaft trifft Praxis“ Verhaltensberatung für hündische „Problemfälle“ an. „Viele Methoden und Erkenntnisse beim Training von Hunden basieren nicht auf wissenschaftlichen Studien, sondern auf Erfahrung“, sagt sie. „Wissenschaftliche Studien sind sehr standardisiert und können die Nuancen einzelner Individuen oft schwer abbilden.“ Doch Erfahrungsberichte können oft Grundlagen für Studien sein, etwa zur Effektivität von Entspannungstraining für Hunde bei Lärmbelastung.

"Mir ist wichtig, dass wir mit unserer Arbeit den Tieren und ihren Menschen auch direkt helfen können."
Gesichter lesen
Um die Emotionen von Hunden noch besser zu verstehen, verwendet Riemer auch künstliche Intelligenz und analysiert damit die Gesichter der Tiere. Zusammen mit dem Computerwissenschaftler George Martvel von der Universität Haifa stellte sie vor Kurzem eine Studie fertig, in der sie mittels Machine-Learning-Algorithmen die Gesichtsausdrücke von Hunden in Videos automatisch erfassten und Indikatoren für Angst ermittelten. Da Hunde viele verschiedene Gesichter haben können, war es bisher nötig, dass Forschende manuell die wichtigsten Punkte (englisch „Landmarks“) in den Gesichtern der Hunde in Videos markieren. Das neue Programm von Martvel wurde auf eine Vielzahl von Hundegesichtern trainiert und kann diese Analyse von selbst durchführen. Der Algorithmus und die manuelle Auswertung stimmten in der kürzlich eingereichten Studie von Riemer und Martvel überein: Der beste Indikator für Geräuschangst ist die Stellung der Ohren, gemessen an der Ohrenbasis. Studien wie diese zeigen, dass Riemer mit ihrer Forschung nicht nur die Grenzen der Wissenschaft vorantreibt, sondern damit auch relevante Einsichten für den Alltag von Hunden und deren Halter:innen erbringt.
Text: Thomas Zauner
alle Fotos: Thomas Suchanek/Vetmeduni
Der Beitrag ist in VETMED 02/2025 erschienen.